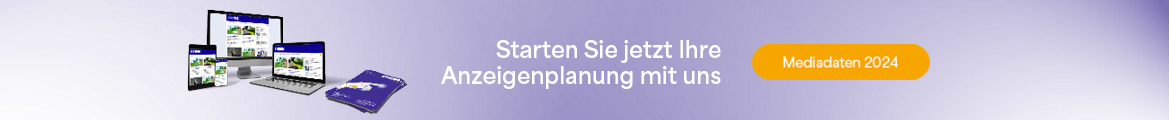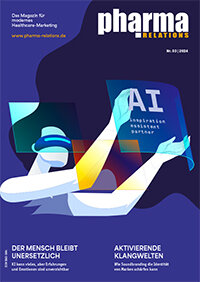Personen
Christian Necker ist neuer Geschäftsführer bei Schmittgall Health
Anfang April hat Necker seine neue Position bei der Stuttgarter Agentur angetreten. Zuletzt verantwortete der 33-Jährige als Mitglied der Geschäftsleitung von Serviceplan Bubble den Ausbau der Geschäftsbereiche Digitale Kommunikation/Social Media und Sponsoring/Brand Partnerships.
Jetzt vier Monate testen
Entdecken Sie Pharma Relations mit unserem unschlagbaren Probeabo! Sie erhalten vier Ausgaben topaktuelles Branchenwissen – monatlich in Ihrem Briefkasten.