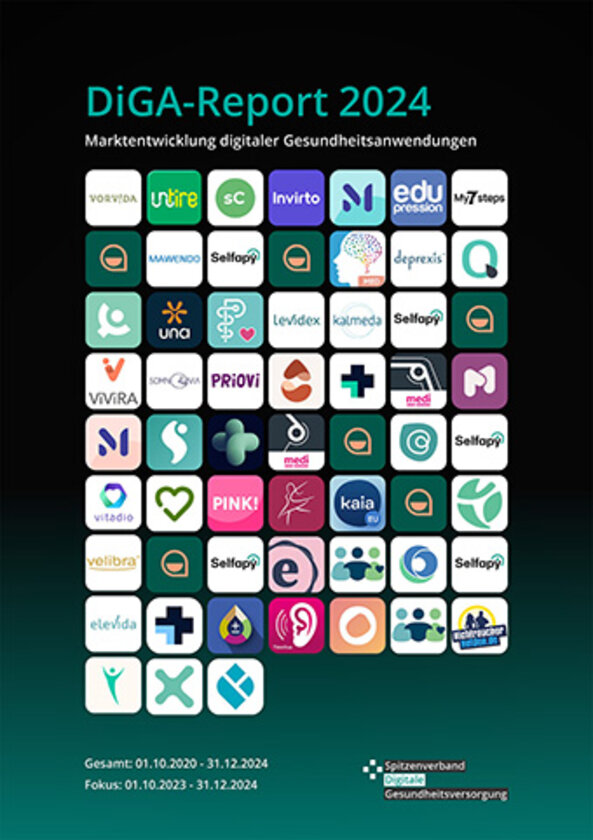Der SVDGV legt mit seinem DiGA-Report eine Analyse zur Entwicklung des Marktes und der Rahmenbedingungen für DiGA in Deutschland vor. Die Ergebnisse des zweiten DiGA-Reports, der auf dem ersten DiGA-Report des SVDGV vom Januar 2024 aufbaut, zeigen, wie sich digitale Therapieoptionen fest in der Versorgung etabliert haben:
- Wachsende DiGA-Vielfalt: Zum Stichtag 31. Dezember 2024 führte das Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 59 DiGA. – 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Im vierten Jahr stehen mehr dauerhaft als vorläufig gelistete DiGA zur Verfügung. Über zwei Drittel der zunächst vorläufig ins BfArM-Verzeichnis aufgenommenen DiGA sind inzwischen dauerhaft gelistet.
- Wachsende DiGA-Inanspruchnahme: Seit der Einführung der DiGA im Herbst 2020 bis zum 31. Dezember 2024 wurden rund 870.000 DiGA-Freischaltcodes eingelöst. Bis zum Stichtag des ersten DiGA-Reports (30. September 2023) waren es noch 374.377 eingelöste Freischaltcodes. Im Vergleich zu den vorhergehenden drei Jahren hat sich damit die Anzahl eingelöster Freischaltcodes in den letzten 15 Monaten des Berichtszeitraums mehr als verdoppelt. Das heißt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des zweiten DiGA-Reports werden fast eine Million Mal Patient:innen mit digitalen Therapieoptionen versorgt.
- Nachhaltiges DiGA-Wachstum: Auch im vierten Jahr wächst der DiGA-Markt mit einer beachtlichen, zweistelligen Wachstumsrate. So wurden im Zeitraum 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024 rund 375.000 Freischaltcodes eingelöst – ein Plus von circa 80 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit etwa 209.000 eingelösten Freischaltcodes.
■ DiGA schließen Versorgungslücken
„Diese Daten bestätigen, dass Patient:innen und Ärzt:innen das Potenzial von DiGA immer mehr schätzen und erkennen, dass DiGA sowohl Versorgungslücken schließen können als auch eine moderne und bessere Gesundheitsversorgung ermöglichen“, erklärt Anna Haas, Vorständin beim SVDGV. „Außerdem spricht die Anzahl der zunächst vorläufig und inzwischen dauerhaft ins BfArM-Verzeichnis aufgenommenen DiGA für das Erfolgsmodell des DiGA-Fast-Track-Verfahrens.”
Nicht zuletzt dank dieses Prozesses würden DiGA inzwischen als Vorbild für die Gesundheitssysteme in anderen Ländern gelten. Zum Beispiel könnten jetzt auch Patient:innen in Frankreich im Rahmen der Regelversorgung von digitalen Therapien profitieren. Als „Innovation made in Germany“ würden sich DiGA quasi zum neuen deutschen „Exportschlager“ entwickeln, stellt der SVDGV fest.
■ Vorschläge für politische Weichenstellungen
Neben den Marktdaten enthält der SVDGV-Report eine detaillierte Analyse der politischen Rahmenbedingungen für DiGA – insbesondere der Auswirkungen des Digital-Gesetzes. Dessen fortschrittlichen Ansätzen stünden zahlreiche Hindernisse im Weg. So blockiere ein bürokratischer und nicht zeitgemäßer Prozess für die Freischaltung eine breitere DiGA-Nutzung. Gleichzeitig würden die regulatorischen Investitionen und Eintrittsbarrieren kontinuierlich steigen, wodurch immer weniger innovative Produkte in die Versorgung gelangten. „Wir appellieren an die Verantwortlichen, die Chance der neuen Legislaturperiode zu nutzen und die regulatorischen Bedingungen für DiGA zu verbessern. Dazu gehört, die Zugangswege und die Einbindung von DiGA in die Versorgung zu vereinfachen. Entscheidend ist außerdem, die überbordende Bürokratie abzubauen“, sagt Henrik Emmert, Vorstand beim SVDGV, „Nur dann können DiGA ihr gesamtes Potenzial entfalten und einen wertvollen Beitrag für eine zukunftsfähige und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung leisten.“
Der SVDGV macht in seinem DiGA-Report konkrete Verbesserungsvorschläge. Dazu gehören der vereinfachte Zugang für Patienten genauso wie der Abbau von bürokratischen Hemmnissen, die gerade junge und innovative DiGA-Unternehmen unverhältnismäßig belasten würden. Wichtig sei zudem, Patienten und Behandler mit den Möglichkeiten von DiGA vertrauter zu machen. Schließlich gehe es darum, das DiGA-Konzept weiterzuentwickeln und als dritten Versorgungssektor fest zu verankern.
■ Kritik am GKV-Report
Deutliche Kritik übt der SVDGV am aktuellen DiGA-Bericht des GKV-Spitzenverbandes. Dieser negiere den Erfolg der evidenzbasierten Therapie mit DiGA, zudem ignoriere er einvernehmlich geschlossene Vereinbarungen und weise gravierende inhaltliche wie qualitative Mängel auf. Der SVDGV kritisiert insbesondere vier „haltlose Behauptungen“ des GKV-Spitzenverbandes zur Preisbildung und Leistungsvergütung sowie zur Evidenz und Therapiefreiheit. Der GKV-Bericht ignoriere nicht nur die „beeindruckende Erfolgsgeschichte“ der DiGA, sondern er erfülle auch nicht den Anspruch einer sachlich-neutralen Ergebniszusammenfassung, so SVDGV-Vorstand Henrik Emmert. Im Bericht des GKV-Spitzenverbandes fänden sich wiederholt Aussagen, die entweder fachlich falsch seien oder die Faktenlage unvollständig bis irreführend darstellten.
So pflege der DiGA-Bericht des GKV-SV an mehreren Stellen das Narrativ, dass Hersteller den Preis für DiGA (im ersten Jahr) „beliebig festlegen“ könnten. Richtig sei, dass für jede DiGA bereits ab Tag 1 nach der Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis Höchstbeträge gelten. Die Grundlagen der Berechnungslogik habe der GKV-Spitzenverband selbst mit den Herstellerverbänden verhandelt.
Im Zusammenhang mit der Preisbildung spreche der GKV-SV von einer „Vorfinanzierung“ oder von „direkter Anschubfinanzierung der Herstellenden“ durch die GKV im ersten Jahr. Richtig sei, dass die Hersteller die rechtlich legitime Vergütung einer gesetzlich definierten Leistung der GKV erhalten. Die Hersteller hätten in die Entwicklung der DiGA einschließlich Studien und Zertifizierung investiert und seien somit erheblich in Vorleistung gegangen, bevor eine DiGA in der Versorgung eingesetzt werden könne und sie dann die ihnen gesetzlich zustehende Leistungsvergütung erhalten.
Mit Blick auf das Erprobungsjahr vermittele der Bericht den irreführenden Eindruck, dass ungeprüfte DiGA, ohne Evidenznachweis, in die Versorgung kommen. Diese Unterstellung sei Teil der generellen Evidenz-Diskreditierung, die sich durch den gesamten DiGA-Bericht des GKV-SV ziehe. Richtig sei, dass die Hersteller auch bei einem Antrag auf vorläufige Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis Studienergebnisse im Rahmen einer systematischen Datenauswertung vorlegen müssen, die einen eindeutigen Hinweis auf einen positiven Versorgungseffekt zeigen.
Schließlich werfe der GKV-Bericht den DiGA-Herstellern „fragwürdige Kooperationen“ und „aggressive Vermarktung“ vor und stelle die medizinische Notwendigkeit von DiGA-Verordnungen in Frage – insbesondere, wenn sie ohne ärztliche Verordnung im Zuge des Genehmigungswegs von den Versicherten selbst bei ihrer Krankenkasse beantragt werden. Richtig sei vielmehr, dass der Gesetzgeber bewusst einen niederschwelligen Zugang zu DiGA – ohne die Notwendigkeit einer ärztlichen Verordnung – geschaffen habe. Ausschlaggebend sei die gesicherte Diagnose, auf deren Basis die Krankenkasse selbst in der Verantwortung zur Prüfung des Leistungsanspruchs stehe. Damit negiere der GKV-SV überdies in fragwürdiger Weise den Behandlungsbedarf der Patienten und die Therapiefreiheit der Ärzte und Therapeuten.