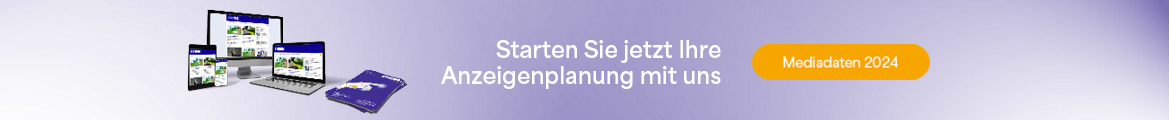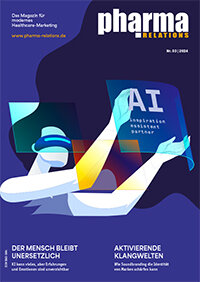Branche
Mediaplus Group und Wefra Life Group übernehmen französische Healthcare-Mediaagentur CMS
Der Pharma- und Gesundheitssektor boomt – und das unabhängig von der Wirtschaftslage. Healthcare- und Pharma-Marketing zählt langfristig zu den attraktivsten Wachstumsmärkten. Die Mediaplus Group und Wefra Life investieren deshalb in den weiteren Ausbau ihrer bereits vorhandenen Infrastruktur in dem wichtigen Marktsegment und übernehmen mehrheitlich die französische Healthcare-Mediaagentur CMS Conseil Média Santé.
Jetzt vier Monate testen
Entdecken Sie Pharma Relations mit unserem unschlagbaren Probeabo! Sie erhalten vier Ausgaben topaktuelles Branchenwissen – monatlich in Ihrem Briefkasten.